Wir haben uns langsam an das Plotting herangetastet, beginnend mit der 3-Akt-Struktur, die sozusagen das Gerüst aller westlichen Plotstrukturen ist und ganz simpel aus Anfang, Mittelteil/Entwicklung und Ende besteht. Bei der 5-Akt-Struktur haben wir uns zusätzlich die Übergänge zwischen den Akten angeschaut, die als Wendepunkte dienen, und sie zu eigenen Akten gemacht. Der Roman ist somit in Anfang, Wendepunkt, Mittelteil/Entwicklung, Wendepunkt und Ende gegliedert.
In diesem Artikel sehen wir uns die 7-Punkt-Struktur an.
Was ist an dieser Struktur anders?
Nichts. Hinter den sieben Punkten liegen auch wieder unsere drei Akte. Wie schon gesagt sind alle westlichen Plotstrukturen vom Prinzip her gleich. Sie sind bloß detaillierter gegliedert (oder geben zusätzlich ein Thema vor). Ja, auch die »komplizierte« Heldenreise ist nur ein sehr, sehr detaillierter 3-Akter.
Wenn keinen inhaltlichen Unterschied gibt, weshalb braucht man verschiedene Plotstrukturen?
Jede*r Autor*in hat ihre*seine eigenen Vorlieben beim Schreiben. Manche schreiben gänzlich frei, manche brauchen die Eckpunkte, an denen sie gelegentlich checken, ob sie auf dem richtigen Weg sind, andere wiederum brauchen ein solides Gerüst und wollen genau festlesen, was als Nächstes passieren muss, damit es dramaturgisch Sinn ergibt. Zusätzlich bekommen die einzelnen Szenen durch die verschiedenen Plotstrukturen eine andere Gewichtung.
Ein Beispiel für die Veranschaulichung:
Im 3-Akter enthält der erste Akt die Einführung der Hauptfigur und des Themas, den Aufbau des Settings, die Andeutung vom Kernkonflikt und der persönlichen Probleme, ein auslösendes Ereignis, eine Notlage, die Zwangslage, die Rumination der Figur und die Entscheidung zu handeln. Kurzum: eine ganze Menge.
Damit keiner der genannten Punkte vernachlässigt oder sogar vergessen wird, werden sie in anderen Plotstrukturen einzeln aufgelistet. Bei der 7-Punkt-Struktur kommt alles unter dem Schlagwort »Setting« in den ersten Akt – also die Einführung der Hauptfigur und der Welt inkl. ihrer persönlichen Probleme. Das auslösende Ereignis, das die Figur aus dem Alltag holt, bekommt einen eigenen Akt, und auch die Not, die daraufhin folgt und wie sich die Hauptfigur daraus befreien will, bekommt ebenfalls einen eigenen Akt. (Bei der Heldenreise wird es noch in kleinere Häppchen aufgeteilt. Der Held soll, weigert sich aber, wird dann von seinem Mentor an den Ohren gepackt, sodass er die beschwerliche Reise antritt – und jeder Schritt davon, ist eine eigene Station.)
Je nach Vorliebe könnt ihr mit einer Prämisse, womit ihr lediglich das Ziel im Kopf habt, oder mit einer genauen Auflistung aller plotrelevanten Faktoren (Heldenreise oder Save-the-Cat-Beat-Sheet) arbeiten.
Zwischen dem weißen Blatt und „Malen nach Zahlen“ steht die 7-Punkt-Struktur, mit der die meisten Autor*innen arbeiten. Sie ist detailliert, aber nicht einengend, und gibt den Wendepunkten ein besonderes Gewicht. Ich mag sie persönlich am liebsten.
Irgendwo hast du was von Gewichtung erzählt. Wo bleibt die denn?
Bei der 7-Punkt-Struktur wird der Wendepunkt noch mal in zwei Teile aufgeteilt, obwohl die erzählte Zeit (die Zeit im Roman) sehr kurz ist. In der ersten Hälfte des Wendepunkts schubst ein ausschlaggebendes Ereignis unseren Protagonisten aus dem Alltag (Plot Turn; deutsch »Wendung«). In der zweiten Hälfte gerät der Protagonist in eine fiese Zwickmühle und wird gezwungen, sich für einen Weg zu entscheiden (Pinch; deutsch »Zwicke«). In der 7-Punkt-Struktur wird dies in zwei separate Akte bzw. Punkte aufgeteilt.
Schauen wir uns mal an, wie wenig Zeit innerhalb des Plot Turns und des Pinchs vergeht:
In Star Wars (Episode IV) begegnet Luke die beiden Droiden, drei Minuten später bekommt er schon die Nachricht der Prinzessin und wird kurz darauf von den Sandpeople angegriffen (Plot Turn). Es vergehen sieben Minuten, bis Obi-Wan Kenobi Luke das Schwert seines Daddys übergibt, und nicht mal fünf Minuten darauf werden auch schon Tante und Onkel getötet (Pinch), sodass sich Luke entscheidet loszuziehen.
Es sind nur zwanzig Minuten, in denen sich das abspielt, aber es sind sehr wichtige zwanzig Minuten für diese Geschichte, denen man besondere Aufmerksamkeit widmen kann. Wer also den ausschlaggebenden Wendungen und den Lebensentscheidungen einen Schwerpunkt geben möchte, fährt gut mit der 7-Punkte-Struktur.
Beachtet den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Wendepunkt. Beim ersten nimmt die Handlung eine Wendung, wodurch die Hauptfigur in eine missliche Lage gerät. Die Figur reagiert auf ihre Umwelt, weicht aus, flieht, duckt sich – sie ist reaktiv (nicht zu verwechseln mit passiv[1]).
Luke wird angegriffen und niedergeschlagen, ihm wird seine Familie und sein Zuhause genommen. Obi-Wan steht ihm währenddessen bei.
Beim zweiten Wendepunkt muss die Figur reflektieren, um zu verstehen, was schiefgelaufen ist; sie muss zur Erkenntnis kommen. Allein das ist schon harte Arbeit, aber es reicht trotzdem nicht. Sie selbst muss etwas unternehmen, um sich aus der Zwangslage zu befreien und somit die letzte Wendung herbeizuführen. Die Figur ist aktiv.
Obi-Wan opfert sich, sodass Luke und die anderen mit den Plänen fliehen können … Luke muss es jetzt aber allein und ohne die Hilfe seines Mentor schaffen, den Todesstern zu zerstören. Und das kann er nur, wenn er sich in den X-Wing setzt, auf seine Macht vertraut und den Torpedo gezielt abschießt.
Jedoch gibt es auch eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Wendepunkten. In diesen Pinch Points (wie man die Wendepunkte auf Englisch nennt) steht die Figur stark unter Druck, sie steht unter Zugzwang, wenn sie sich nicht zusammenreißt, verliert sie alles.
Zusätzlicher Tipp:
Geschichten werden als besonders spannend wahrgenommen, wenn die Hauptfigur viel aufs Spiel setzen muss und viel zu verlieren hat. Da in den Wendepunkten sehr viel passiert, was das Leben der Hauptfigur verändert, bieten sie sich besonders gut dafür an, an diesen Szenen die Fallhöhe noch mal größer zu machen.
Um herauszufinden, ob die Fallhöhe stark genug ist, könnt ihr euch folgende Fragen stellen:
- Hat die Hauptfigur die Möglichkeit, sich vor der Entscheidung zu drücken?
- Hat die Hauptfigur die Möglichkeit, einen einfacheren Weg zu wählen?
- Hat die Hauptfigur die Möglichkeit, nach seiner Aufgabewieder in den Alltag vom Anfang zurückzukehren?
- Was passiert, wenn die Hauptfigur keine Entscheidung trifft?
- Was passiert, wenn die Hauptfigur die falsche Entscheidung trifft?
- Was passiert, wenn die Hauptfigur bei seiner Aufgabe scheitert?
Gut. Der Plot ist kein Zuckerschlecken. Kein normaler Mensch würde die Geschichte freiwillig durchmachen wollen. Daher müsst ihr die Situation für eure Figur so aussichtslos machen, dass sie keine andere Wahl hat, als zu kämpfen.
Sorgt für eine tödliche Fallhöhe.
Erst wenn die Figur am Rande des Abgrunds steht,
wird sie um ihr Leben kämpfen.
Erinnert ihr euch noch an die Millionärin Nora, die mit Partys und Nachtlicht ihre Schuldgefühle und die Panikattacken vor der Dunkelheit verdrängen will? Welchen Grund könnte man ihr geben, damit sie sich endlich ihren Ängsten stellt?
Ist ihr Nachtlichtlein mit den 0,2 Watt und den Jahreskosten von 50 Cent zu teuer für eine Millionärin? Ähm, ja …
Vernachlässigt sie durch die regelmäßigen Partys ihre Arbeit und wird pleite? – Wir kommen der Sache schon näher. Aber theoretisch hat sie genug auf der hohen Kante, und außerdem tut ein stinknormaler Halbtagsjob auch niemandem weh.
Vielleicht leidet sie durch ihre Lebensführung an einer Krankheit, zum Beispiel Hörverlust durch Schlafmangel. Oder sie wird schwanger, will jedoch das Kind behalten und möchte gesundes Leben ohne Alkohol führen. Vielleicht schafft sie es nicht, sich zusammenzureißen, und verliert das Kind. Womit wir dann eine zweite Person hätten, die ihretwegen sterben musste. Da verdoppeln sich die Schuldgefühle. Tja, der Plot ist kein Zuckerschlecken.
Wie sieht es mit eurer Hauptfigur aus? Kommt sie zu einfach davon?
Dann nagelt ihn fest, damit er nicht fliehen kann, und zwingt ihn, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Und mit „nageln“ meine ich nicht die Handlung für Erwachsene, sondern mit einem rostigen Metallnagel am Boden festnageln. Ob es das Hosenbein oder der Fuß ist, bleibt euch überlassen.

[1] Vielleicht habt ihr schon mal von der Schreibregel gehört, dass die Hauptfigur aktiv sein solle. Dem stimme ich zu, denn passive Figuren langweilen die Leser*innen. Doch passiv ist nicht mit reaktiv verwechseln. Während passiv zu sein, bedeutet, dass die Hauptfigur gar nichts tut, reagiert die reaktive Hauptfigur auf das Schicksal, bis sie sich entscheidet, aktiv zu werden und das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

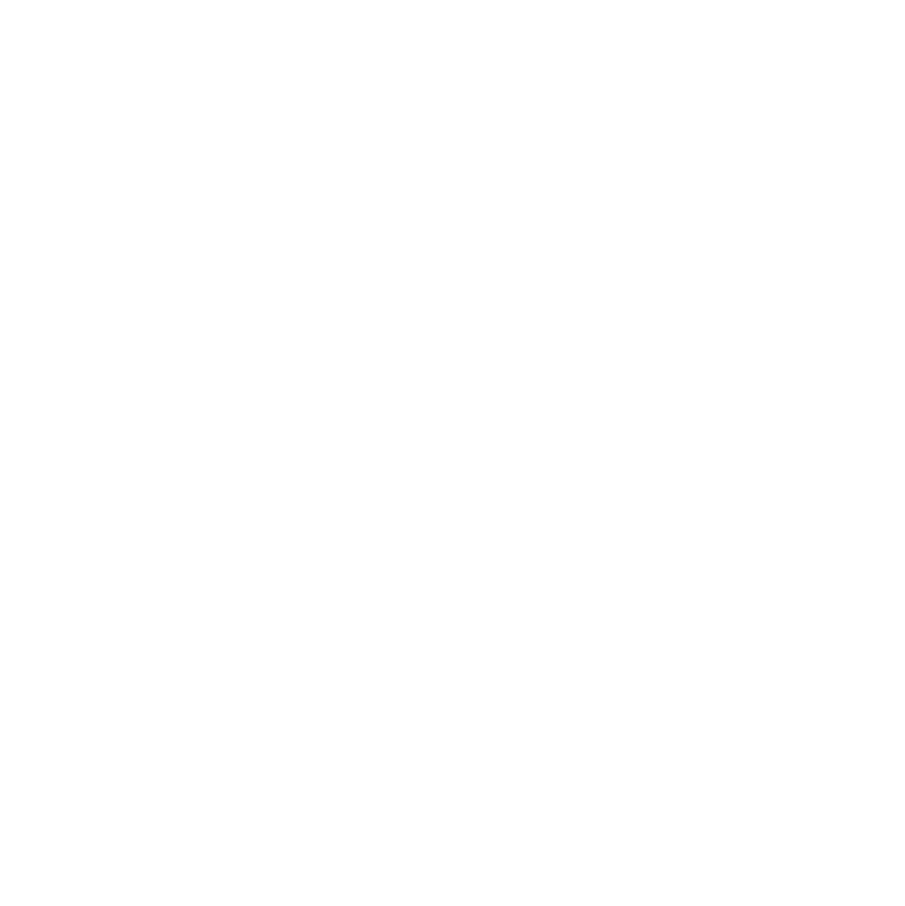

Toller Artikel! Danke!