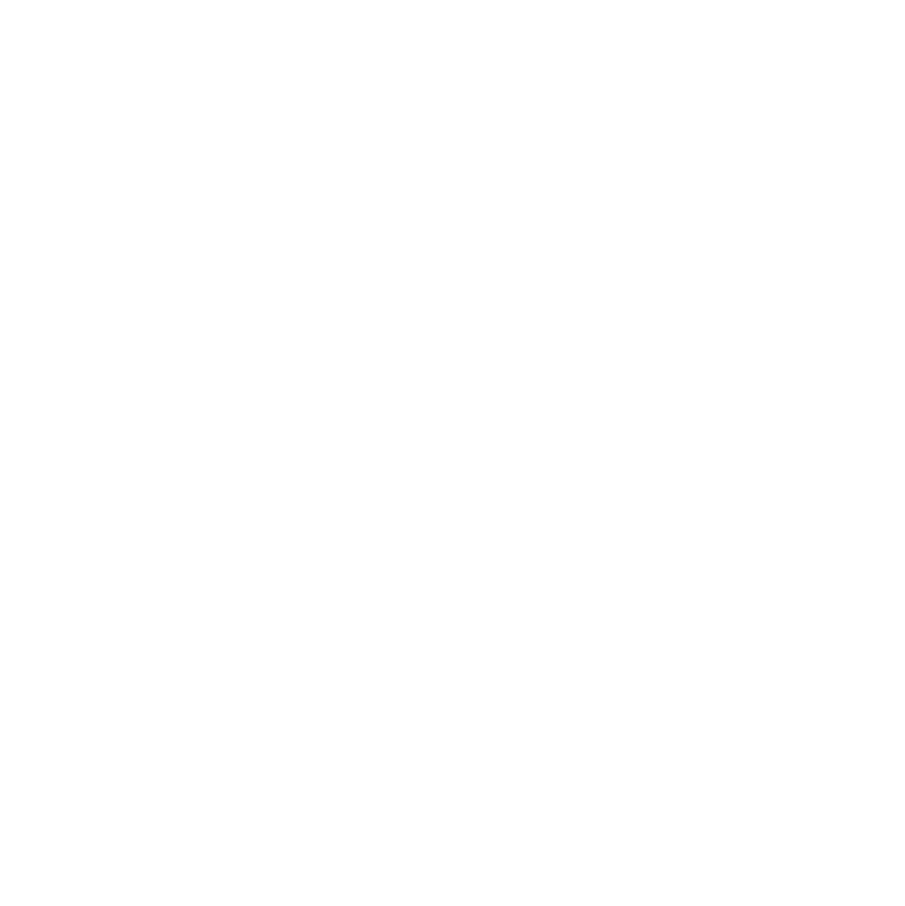Wir haben uns letzten Monat damit beschäftigt, treffende Adjektive für unsere Texte zu finden. Es gibt aber noch mehr Wortarten, deren Verwendung einen großen Einfluss auf die Wirkung eines Textes hat. Deswegen nehmen wir uns heute die
Verben
vor. Die allermeisten Sätze haben Verben. Verben bedeuten Handlung, und Handlung ist in Geschichten ein nicht zu verachtender Pluspunkt. Also verwenden wir fleißig Verben!
Viele!
Yay!
Ding ist, genauso wie man einen Text mit nichtssagenden Adjektiven zumüllen kann, kann man ihn auch mit langweiligen Verben pflastern.
haben und sein
Zwei der häufigsten Verben im Deutschen sind haben und sein (natürlich zusammen mit ihren Konjugationsformen wie hat, bin, war, hattest, seid, ist etc.). Haben und sein sind der Tofu der deutschen Sprache; ohne viel Eigengeschmack, aber richtig gewürzt kann man sie fast in jeden Satz einschmuggeln. Allerdings hat Worttofu im Vergleich zu variationsreicheren Textzutaten keinerlei Vorteile. Letztere kosten das Gleiche, sind in unbegrenzten Mengen verfügbar, und man riskiert auch keine Bienenstiche oder Salmonellen bei der Beschaffung. Warum also mühsam Tofu würzen, wenn man gleich echte Vollverben verwenden kann?
Wenn man einen Text schreibt, schleichen sie sich trotzdem oft genug ein, denn sie drängen sich praktisch auf, wenn man z. B. Zustände ausdrücken will:
Ich bin müde.
Er hat Kopfschmerzen.
Der Orangensaft ist sauer.
Das Pferd ist weiß.
Das muss aber nicht so sein. Mit ein paar Tricks und Satzumstellen kann man dieselben Dinge mit interessanteren Verben ausdrücken:
Müdigkeit überkommt mich.
Ihn quälen Kopfschmerzen.
Der Orangensaft schmeckt sauer.
Der Schimmel frisst kein Tofu.
Haben und sein lassen sich nicht überall vermeiden, und das ist auch nicht Sinn der Sache, aber wenn man ein bisschen darauf achtet, stellt man überrascht fest, wie oft man sie einsparen kann.
Die Häufigkeit der beiden wird besonders dröge, wenn wir eine Textstelle haben, die in einer Zeitform geschrieben ist, die haben und sein als Hilfsverben nun einmal braucht. Im Deutschen gibt es bekanntlich zwei Vergangenheitsformen, das Präteritum und das Perfekt. Das Perfekt wird mit den Hilfsverben haben oder sein + dem Partizip II gebildet, und da diese Hilfsverben praktisch in jedem Satz vorkommen, klingt das auf Dauer ganz schön monoton:
Kid hat sich auf die Knie geworfen und hat den Kopf in die Arme vergraben, als die Glassplitter auf ihn herabgeregnet sind. Als das Wesen vor ihm explodiert ist, hat er sich unsanft auf den Hintern gesetzt und ist rückwärts bis zur Wand gekrabbelt. Elektrische Entladungen sind über den zuckenden Körper gezüngelt und haben kleine Flammennester auf seiner Kutte entzündet. Der kleine Raum hat sich mit dem Geruch von verschmortem Gummi und schwelendem Filz gefüllt.
Das Präteritum hat dagegen für jedes Verb seine ganz eigene Form, und ist daher variationsreicher. Überraschenderweise verwenden Texte, die in der Vergangenheitsform geschrieben sind, daher auch meistens das Präteritum:
Kid warf sich auf die Knie und vergrub den Kopf in den Armen, als Glassplitter auf ihn herabregneten. Als das Wesen vor ihm explodierte, setzte er sich unsanft auf den Hintern und krabbelte rückwärts bis zur Wand. Elektrische Entladungen züngelten über den zuckenden Körper und entzündeten kleine Flammennester auf seiner Kutte. Der kleine Raum füllte sich mit dem Geruch von verschmortem Gummi und schwelendem Filz.
Wenn wir noch ein Stückchen weiter in die Vergangenheit wollen, landen wir beim Plusquamperfekt, und da haben wir dann leider keine Wahl mehr. Es wird immer mit hatten oder war + Partizip II gebildet:
Als der Prinz verzaubert worden war, war er noch kein kleiner Junge gewesen. Er hatte sich geweigert, der Zauberin Unterschlupf zu gewähren.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Tofuwelle zu umgehen. Die eine ist, Rückblenden nur sparsam in einer Geschichte einzusetzen, denn diese sind die Hauptverdächtigen bei übermäßigem Plusquamperfekt-Gebrauch. Wenn er aber eine längere Rückblende braucht, dann leitet der durchtriebene Autor diese durch 1–2 Sätze im Plusquamperfekt ein und schlüpft dann unauffällig ins Präteritum zurück, als wäre nichts gewesen:
Die Zauberin hatte daraufhin ihn und das ganze Schloss verflucht. Die Diener wurden zu Möbeln und Geschirr, und der Prinz verwandelte sich in ein unglaublich hässliches Biest.
Solange die Handlung zusammenhängt, begreift der Leser auch ohne Plusquamperfekt, dass er sich weiterhin in der Rückblende befindet.
Modalverben
können müssen sollen dürfen mögen wollen
Meiner Erfahrung nach sind diese Verben in belletristischen Texten selten problematisch. In Fach- oder Werbetexten kann man dagegen oft auf sie verzichten.
Wir wollen Ihnen helfen!
-> Wir helfen Ihnen!
Sie können unser Geschäft in der Hauptstraße 27 finden
-> Sie finden unser Geschäft in der Hauptstraße 27
Aber auch in einem Romanmanuskript lohnt es sich, mal abzuchecken ob
Er musste schlucken
oder
Er schluckte
im Einzelfall dynamischer klingt.
gehen
Figuren gehen riesige Strecken in ihren Welten herum. Sie gehen eine Treppe hinauf, in den Keller hinunter, zur Tür hinaus oder dem Leser auf die Nerven. Aber wenn man genauer hinsieht, sind diese Bewegungen ganz unterschiedlich. Man kann schnell oder langsam gehen, mühsam oder leichtfüßig. Anstatt nun zu schreiben „sie ging leichtfüßig in den Keller hinunter“ können wir auch gleich ein schöneres Verb suchen, das sowohl das ausgelutschte „gehen“ als auch das Adjektiv in sich vereint und schreiben „Sie hopste die Kellertreppe hinunter“.
sagen
„Figuren reden auch eine ganze Menge zwischen den Buchdeckeln eines Romans, vermutlich noch mehr, als sie sich fortbewegen“, sagte ich.
„Um anzuzeigen, wer spricht, setzt man üblicherweise eine Inquit-Formel hinter die wörtliche Rede“, sagte Sergeant Käsefuß.
„Auf die Dauer wird immer nur ‚sagte‘ aber ziemlich eintönig“, sagte ich.
„Man könnte diese Inquit-Formeln ja auch durch abwechslungsreichere Verben ersetzen“, schlug Sergeant Käsefuß vor.
„Man muss allerdings aufpassen, dass man es mit der Variation nicht übertreibt“, ließ ich verlauten.
„Was willst du damit insinuieren?“, retournierte Sergeant Käsefuß.
„Dass es manchmal vielleicht besser ist, wenn man die Inquit-Formel ganz weglässt. Vor allem, wenn sowieso klar ist, wer gerade das Wort hat.“
„Und im Zweifelsfalle kann man dem sprechenden Charakter auch eine Handlung beiordnen, dann ist klar, wer spricht, und hat gleichzeitig noch ein Szenenbild erschaffen.“ Sergeant Käsefuß pustete eine Haarsträhne aus den Kulleraugen und lehnte sich zufrieden zurück.
sehen
Von großem Interesse erweisen sich oft die Dinge, die eine Figur während ihrer Abenteuer sieht. Benutzt einmal spaßeshalber die Suchfunktion eures Textprogrammes und seht nach, wie oft das Wort „sehen“ in eurem Manuskript zu sehen ist. Ihr werdet vielleicht sehen, es ist eine ganze Menge.
Ein erster Schritt wäre, die entdeckten Wörter durch andere Verben zu ersetzen; aber auch hier ist die Auswahl begrenzt:
blicken/erblicken, anschauen, betrachten, mustern, sichten, entdecken, bemerken, erkennen, beobachten
Glücklicherweise ist es oft überhaupt nicht nötig, hinzuschreiben, dass die Figur etwas sieht. Es genügt in vielen Fällen zu schreiben, was sie sieht:
Er sah, wie das Schiff in den Hafen einlief.
-> Das Schiff lief in den Hafen ein.
Der Leser wird nicht innerhalb eines Satzes den Draht zum Perspektivcharakter verlieren, nur weil er ausnahmsweise mal nicht das Subjekt ist. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Sinneseindrücke wie hören, spüren, riechen, fühlen und schmecken.
tun und machen
Ich tue mich schwer damit, Autoren den Vorschlag zu machen, dass sie diese beiden Worte nicht übermäßig verwenden tun sollen. Die meisten machen das nämlich sowieso nicht, weil es sich ziemlich kindisch anhören tut. Trotzdem tut sich manchmal so ein Wort einschleichen, in welchem Fall man es am besten schnell wegmacht.
Aufgabe:
Nimm dir eine Textstelle aus deinem Manuskript vor. Streiche alle Verben an. Gibt es Verben, die du häufig gebrauchst? Gibt es Verben, die dir langweilig vorkommen? Formuliere die betreffenden Sätze um und suche interessantere Verben.